Smeil Award Nominierung
Von Dr. Oliver Everling | 23.November 2020
Themen: Nachrichten | Kommentare deaktiviert für Smeil Award Nominierung
Spielend mehr Umsatz
Von Dr. Oliver Everling | 19.November 2020
Bilibili Inc. („Bilibili“ oder das „Unternehmen“, NASDAQ: BILI), eine führende Online-Unterhaltungsplattform für junge Generationen in China, gab heute ihre ungeprüften Finanzergebnisse für das am 30. September 2020 endende dritte Quartal bekannt.
Höhepunkte des dritten Quartals 2020: Der Gesamtnettoumsatz erreichte 3.225,7 Mio. RMB (475,1 Mio. USD), eine Steigerung von 74% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die durchschnittlichen monatlichen aktiven Benutzer (MAUs) erreichten 197,2 Millionen und die mobilen MAUs 183,5 Millionen, was einem Anstieg von 54% bzw. 61% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019 entspricht. Die durchschnittlichen täglichen aktiven Benutzer (DAUs) erreichten 53,3 Millionen, ein Anstieg von 42% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019. Die durchschnittlichen monatlich zahlenden Benutzer (MPUs1) erreichten 15,0 Millionen, eine Steigerung von 89% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019.
„Wir freuen uns, ein weiteres großartiges Quartal mit einem außergewöhnlichen Wachstum sowohl der Nutzerzahlen als auch unserer Umsatzrendite bekannt zu geben“, sagte Rui Chen, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer von Bilibili. „Unsere effektive Strategie für das Benutzerwachstum und die Erweiterung der Inhaltsbibliothek haben uns geholfen, ein noch breiteres Publikum zu erreichen. Im August überstiegen unsere MAUs 200 Millionen und markierten damit einen neuen Monatsrekord. Dieser Meilenstein ist nur der Anfang. Wir gehen davon aus, dass der unvermeidliche Trend zur Videolisierung Bilibili große Chancen bieten wird, als Anlaufstelle für Online-Inhalte in China zu wachsen und zu expandieren. Da wir unsere Kernkompetenzen nutzen, um ansprechende Inhalte und Community-Erfahrungen bereitzustellen, sind wir bestrebt, unseren Markenwert weiter zu verbessern und diese Marktchance zu nutzen. Wir glauben, dass die Investitionen, die wir jetzt tätigen, um unsere Hochburg auf dem chinesischen Unterhaltungsmarkt zu stärken, auf lange Sicht eine beträchtliche und nachhaltige Rendite bringen werden. “
Herr Sam Fan, Finanzvorstand von Bilibili, sagte: „Unser starkes Benutzerwachstum treibt unsere Umsatzsteigerung weiter voran. Im dritten Quartal erzielten wir ein weiteres Quartal mit einem Rekordumsatz von 3,2 Mrd. RMB, was einer Steigerung von 74% gegenüber dem Vorjahr entspricht und erneut das obere Ende unserer Prognose übertrifft. Mit der Einführung von mehr Premium-Inhalten und -Diensten wurde mehr Verkehr in zahlende Benutzer umgewandelt und unsere allgemeine Zahlungsquote verbessert. Die MPUs beliefen sich im dritten Quartal auf 15,0 Millionen, was einem Anstieg von 89% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Wir sind auch froh, dass wir im sechsten Quartal in Folge eine Verbesserung der Bruttomarge auf 23,6% erreicht haben. Mit Blick auf die Zukunft sind wir entschlossen, unsere Wachstumsstrategie umzusetzen und in Wachstum zu investieren, von dem wir glauben, dass es allen unseren Stakeholdern einen langfristigen Wert bringen wird. “
Themen: Aktienrating, Technologierating | Kommentare deaktiviert für Spielend mehr Umsatz
Unternehmenstransformation an Praxisbeispielen der Digitalisierung verstehen
Von Dr. Oliver Everling | 18.November 2020
Zur Online-Konferenz UnternehmensTRANSFORMATION 2020 des Frankfurt School Verlags gibt der Chief Digital Officer ERGO Group und Vorsitzende des Vorstands der ERGO Digital Ventures AG, Mark Klein, den Aufschlag: „Um Digitalisierung erfolgreich umzusetzen, fokussieren Sie sich nicht nur auf Technologie, sondern insbesondere auch auf kulturelle Aspekte! Nehmen Sie Sorgen und Bedenken ernst und entkräften diese durch Transparenz und Entmystifizierung! Machen Sie Digitalisierung im Tagesgeschäft erlebbar und nehmen Sie Ihre Mitarbeiter aktiv mit!“
Für seine Aufgabe bei der ERGO Gruppe bringt Klein beste Voraussetzungen mit: Studium des Maschinenbaus sowie Studium der Betriebswirtschaftslehre an der RWTH Aachen, McKinsey & Company, Inc., Speed Ventures GmbH, Vodafone D2-GmbH, Vodafone D2-GmbH, Deutsche Telekom AG und T-Mobile Netherlands B.V. Der Weg in die Zukunft mit Digitalisierung ist vorgezeichnet. „Gehen Sie das Thema an!“
„Über die Hälfte unseres globalen Revenues kommt aus dem eCommerce“, führt Dr. Hanna Huber in ihrem Vortrag das Thema fort. Dr. Hanna Huber verantwortet die Technologie-Strategie der otto group, die die Entwicklung zu einem voll digitalisierten Handels- und Dienstleistungskonzern vorantreibt. Zusammen mit Tech-Experten aus dem Konzern definiert sie übergreifende IT-Governance-Prozesse und entwickelt Standards für Architektur, Software und Arbeitsweisen. Hanna Huber begann ihre Laufbahn während der New Economy in Multimedia-Agenturen und studierte Electronic Business an der Udk Berlin. Für ihre Doktorarbeit an der Freien Universität Berlin untersuchte sie Innovations-Verbreitungsprozesse mittels agentenbasierter Computersimulation. Vor der otto group verantwortete sie bei Zalando als Director Technology Governance die Operationalisierung der Tech-Strategie; davor war sie COO einer Berliner Social Media Unternehmensberatung.
„Auf welche Technologien sollen wir setzen? Blockchain?“ Das sei eine verbreitete Frage. Dabei komme es doch auf die Anwendungsfälle an, so dass es darauf keine pauschale Antwort geben könne. Umgekehrt könne auch nicht bloß aus der Geschäftsstrategie abgeleitet werden, welche Technologien entwickelt werden sollen. „Tech ist wie ein Brennglas, man muss sehen, ob die Technologien, die man sich auf PowerPoint ausgedacht hat, funktionieren oder nicht.“
In der otto group bestimmt ein Tech Board die generelle Richtung technologiebezogener Entwicklungen. Dieses ist mandatiert vom Management Board und interagiert mit „Tech Strategy & Governance“, „Tech Council“ und dazwischen mit verschiedenen Expertenzirkeln.
Schwerpunktthemen sieht Huber beispielsweise in Zahlungssystemen, E-Commercestack, Lagersystemen, Maschine Learning, Security & Privacy. IT und Tech ist für Huber nicht dasselbe. IT berichte oft an den CFO und wird als „Commodity“ gesehen. Effizienter machen, Kosten sparen, niedrige Mangement Attention, IT-Leute sollen die Vorschläge machen – das sei hier das Mindset. Tech sei dagegen vielmehr ein Investmentthema, eine Grundeinstellung. Hiermit identifiziert sich ein Unternehmen.
Bei „Tech“ gehe es darum, etwas Neues zu entwickeln. „Für alle, die sich mit Technologie nicht auskennen, ist Tech natürlich eine Bedrohung“, räumt Huber ein. Daher komme es darauf an zu verstehen, worum es geht. „Einsicht ist nicht mehr genug, sondern muss Leute mit Tech-Background an den Entscheidungspositionen haben.“ Der Vortrag von Huber gibt einen tiefen Einblick in die Voraussetzungen, die in einem Unternehmen wie der otto group erfüllt sein müssen, um die Digitalisierung erfolgreich umzusetzen.
Auch beim Versandhaus otto gab es einen legendären Katalog wie bei Quelle, einst das führende Versandhaus Europas. Während Quelle vom Markt verschwand, schaffte otto den Wandel. „Deutsch als Sprache ist ein absoluter Killer“, warnt Huber, wenn man in der Technologie führend sein wolle. Hier gehe es nur mit Englisch weiter. Zentral versus dezentral: Wenn es um Commodity-Themen gehe, wie beispielsweise Buchhaltung, spreche viel für die Zentralisierung. „Vielleicht die Hälfte meiner Zeit verwende ich darauf, die richtigen Incentive Schemes zu finden“, sagt Huber mit Blick auf zentralisierte Ansätze, zumal diese meist langsamer sind.
„Bei uns gibt es kein pauschal zentral oder dezentral“, sagt Huber und gibt Beispiele – wie aus der Logistik – dafür, in welchen Fällen Funktionen zentralisiert und in welchen Fällen dezentralisiert wurden. Zwischen zentralen und dezentralen Lösungen gebe es natürlich auch Verknüpfungen. Huber zeigt auf der Konferenz des Frankfurt School Verlags auf, nach welchen Architekturprinzipien bei der otto group gearbeitet wird.
Themen: Technologierating | Kommentare deaktiviert für Unternehmenstransformation an Praxisbeispielen der Digitalisierung verstehen
Morningstar integriert ESG formell in die Analyse von Aktien, Fonds und Asset Managers
Von Dr. Oliver Everling | 17.November 2020
Da das Vermögen und das Interesse an nachhaltigem Investieren weiter zunehmen, integriert Morningstar die ESG-Risiken in die Analyse, um die Nachfrage der Anleger nach eingehenden qualitativen und quantitativen Untersuchungen zur Kuratierung der ESG-Investitionsentscheidungen zu befriedigen. Morningstar hat begonnen, Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) offiziell in seine Analyse einzubeziehen von Aktien, Fonds und Vermögensverwaltern.
Analysten von Morningstar Equity Research werden ein global konsistentes Framework anwenden, um das ESG-Risiko für über 1.500 Aktien zu erfassen. Analysten identifizieren bewertungsrelevante Risiken für jedes Unternehmen anhand der ESG-Risikobewertungen von Sustainalytics, die das Risiko eines Unternehmens für wesentliche ESG-Risiken messen, und bewerten dann die Wahrscheinlichkeit, mit der diese Risiken eintreten, und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Bewertung. Die Ergebnisse dieses Research werden Morningstars Einschätzung des inneren Werts einer Aktie und des erforderlichen Sicherheitsspielraums beeinflussen, bevor ein Morningstar Rating™ für Aktien zwischen fünf und einem Stern vergeben wird. Morningstar hat im Juli 2020 Sustainalytics, einen weltweit anerkannten Marktführer für ESG-Ratings und -Forschung, übernommen.
Research-Analysten von Morningstar Manager werden analysieren, inwieweit Strategien und Asste Manager ESG-Faktoren im Rahmen ihrer neuen Bewertung des Morningstar ESG Commitment Level berücksichtigen. Bei der Durchführung der Strategiebewertung beurteiln die Analysten die für jede Strategie eingesetzten Analysen und Mitarbeiter sowie das Ausmaß, in dem die Strategie diese Ressourcen in den Anlageprozess einbezieht. Um die Bewertung von Asset Managers durchzuführen, werden Analysten prüfen, wie klar das Unternehmen seine ESG-Philosophie und -Richtlinien formuliert hat und inwieweit es diese Richtlinien durch seine Kultur und in Anlageprozessen vorangetrieben hat. Die ESG Commitment Level-Bewertung von Strategien und Vermögensverwaltern erfolgt nach einer Vier-Punkte-Skala von Leader, Advanced, Basic und Low.
Haywood Kelly, Research-Leiter von Morningstar, kommentiert: „Für Unternehmen ist die Bewertung des ESG-Risikos eine geschäftliche Notwendigkeit, um sowohl die unterschiedlichen Bedürfnisse der Stakeholder zu erfüllen als auch potenzielle rechtliche, operationelle oder Reputationsrisiken zu mindern. Die Aktien- und Manager-Research-Teams von Morningstar zielen darauf ab, diese Trends anzugehen und Investoren durch langfristige methodische Research-Ansätze zu stärken, unterstützt durch qualitative Analyse und unabhängiges Denken.“
Themen: Aktienrating, Fondsrating, VV-Rating | Kommentare deaktiviert für Morningstar integriert ESG formell in die Analyse von Aktien, Fonds und Asset Managers
Globalance erlaubt neuartigen Blick auf den Globus
Von Dr. Oliver Everling | 16.November 2020
Globalance Bank lanciert Globalance World, eine Weltneuheit in Form einer digitalen und interaktiven Weltkugel für nachhaltige Anlagen. Unter www.globalanceworld.com können Anleger und Finanzinteressierte kostenlos die Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit von aktuell über 6.000 börsennotierten Unternehmen und ausgewählten Aktienindizes bezüglich ESG, Klimawandel und Megatrends analysieren und beurteilen.
Die Informationsplattform Globalance World baut auf dem 2012 eingeführten Globalance Footprint® auf und erweitert diesen um die interaktive Dimension: Nutzer können sich darüber informieren, welchen Klimapfad ihre Investments aufweisen, in welche Megatrends ihr Vermögen investiert ist und wo auf der Welt beziehungsweise in welchen Ländern ihre Anlagen einen positiven oder negativen Fußabdruck bewirken.
Es handelt sich nicht um ein weiteres ESG-Rating, wie es von Moody’s, Morningstar, ISS und anderen angeboten wird. Die Plattform eröffnet vielmehr eine neuartige Perspektive und interaktive Darstellung tagesaktueller Daten von tausenden Unternehmen, verknüpft mit relevanten News und Erläuterungen in Kurzform. Die Nutzer können Aktien, Portfolios und Indizes anhand von Kriterien wie CO2-Emissionen, Klimaerwärmung (gemessen am globalen Klimaziel von 2 Grad Celsius Temperaturanstieg), aktuellen Megatrends und weiteren, zukunftsgerichteten Parametern beurteilen.
Beispiel: Das Klimaerwärmungspotenzial des SPI liegt bei 3,8 Grad respektive des DAX bei 4,3 Grad, des S&P 500 bei 3,3 Grad und des Shanghai Index bei 4,3 Grad. Die Auswertungen basieren auf Rohdaten und Analysen von anerkannten Datenlieferanten wie Carbon Delta, MSCI, Morningstar oder Factset, welche die Globalance-Spezialisten mit ihrer eigenen, in achtzehnmonatiger intensiver Arbeit entwickelten Methodik verknüpfen und ergänzen. Reto Ringger, Gründer und CEO von Globalance, beschreibt die jüngste Entwicklung und Weltneuheit der innovativen, auf nachhaltige Anlagen fokussierten Privatbank als „Google Earth für Anleger“.
Die in Deutsch und Englisch verfügbare Plattform will mit ihren zahlreichen interaktiven Darstellungen neue Maßstäbe bei der visuellen Umsetzung von „Big Data“ setzen. Es geht um einen individualisierten Blick auf die Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit von einzelnen Anlageinstrumenten und Portfolios. Die Globalance World-Plattform deckt bereits ein großes globales Aktienuniversum ab und wird laufend mit neuen Anlageklassen und Unternehmensinformationen ergänzt.
Referenzbeispiele ermöglichen zusätzliche Einsichten. Beispielsweise veröffentlicht der Schweizer Solarflug-Pionier Bertrand Piccard sein privates Anlageportfolio auf Globalance World und macht es für Vergleiche und Querinformationen zugänglich. Grundfunktionen wie das Analysieren einzelner Unternehmen sollen auf Globalance World kostenlos und anonym möglich sein. Registrierten Nutzern bietet sich darüber hinaus die Möglichkeit, die eigenen Aktienanlagen auf der Plattform zu analysieren und mit anderen Portfolios/Indizes zu vergleichen. Kunden von Globalance können weiterführende Marktkommentare und Footprint-Analysen, sogenannte Globalance Insights, abonnieren.
Mit ihrer innovativen Plattform richtet sich Globalance an ein breites Publikum von privaten und institutionellen Anlegern. In Deutschland ist die Bank mit der Vermögensverwaltung Globalance Invest vertreten.
Reto Ringger unterstreicht angesichts der jüngsten Innovation von Globalance: „Wir stellen bei vielen Anlegergruppen ein zunehmendes Bedürfnis nach umfassender Transparenz zu den Auswirkungen ihrer Investitionen fest. Dazu zählen insbesondere Frauen, Millennials und Anleger, die eine Schenkung oder ein Erbe antreten, wie auch Stiftungen. Gerade jüngere Generationen wollen mit ihren Investitionen keine irreparablen Schäden an Gesellschaft und Umwelt mitverantworten, sie streben bei der Geldanlage neben finanziellen Erträgen auch einen positiven Wandel und Beiträge an die Lösung aktueller Herausforderungen unserer Zeit an. Auch institutionelle Investoren werden sich ihrer Verantwortung, die sie mit ihrer Anlagepolitik wahrnehmen müssen, verstärkt bewusst – etwa der Anlage eines Stiftungsvermögens im Einklang mit dem Stiftungszweck. Mit Globalance World machen wir unseren Globalance Footprint® und weitere zukunftsrelevante Daten erstmals interaktiv erlebbar. Die Weltneuheit erlaubt den Nutzern, die komplexen Zusammenhänge der Geldanlage besser zu verstehen und verantwortungsbewusste Anlageentscheidungen zu treffen.“
Werner Hedrich, Geschäftsführer von Globalance Invest, ergänzt: „Mit Globalance World bieten wir allen Finanzinteressierten einen kostenlosen und interaktiven Zugang zu Informations- und Analysemöglichkeiten in einer Visualisierung und Detailtiefe, die in dieser Form einzigartig sind. Im Fokus stehen dabei innovative und zukunftsorientierte Unternehmen, welche die globalen Herausforderungen und Megatrends erfolgreich adressieren und dabei eine positive Wirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt erzielen.“
Themen: Aktienrating, Cleantechrating, ETF-Rating, Nachhaltigkeitsrating | Kommentare deaktiviert für Globalance erlaubt neuartigen Blick auf den Globus
Neue Möglichkeiten zur Restrukturierung
Von Dr. Oliver Everling | 16.November 2020
„Das neue Jahr wird für Unternehmen in der Krise völlig neue Möglichkeiten für eine Restrukturierung bringen“, so kommentiert Ines Löwentraut, CEO von Avivre Consult GmbH in Bad Homburg den Regierungsentwurf, der zum 1. Januar 2021 in Kraft treten soll. „Derzeit wird über den Regierungsentwurf eines Gesetzes für ein vorinsolvenzliches Restrukturierungsverfahren verhandelt, das ab dem 01.01.2021 gelten soll. Der Gesetzgeber ist durch eine Richtlinie der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2019 verpflichtet, dieses neue Restrukturierungsverfahren in nationales Recht umzusetzen. Gleichzeitig ist vor der aktuellen Corona bedingten Entwicklung der politische Wille vorhanden, mit diesem neuen Verfahren eine Insolvenzwelle zu vermeiden.“
Dabei werden Unternehmen in der Krise Restrukturierungsinstrumente bereitgestellt, die bislang undenkbar waren, zeigt Ines Löwentraut auf. Ziel des Verfahrens ist die Vermeidung eines Insolvenzverfahrens. Insbesondere kann das Verfahren „still“ durchgeführt werden und es soll ein Schuldenschnitt nur mit ausgewählten Gläubigern, z.B. Finanzgläubigern ermöglicht werden.
„Das operative Geschäft wird also – anders als bei einem Insolvenzverfahren – nicht beeinträchtigt,“ folgert die Expertin, „da diese Geschäftspartner nicht in das Verfahren einbezogen werden müssen. Dieses Verfahren ermöglicht daneben eine Änderung des Geschäftsmodells, da man sich zugleich auch vorzeitig aus langfristigen Verträgen lösen können soll. Dies soll auch Mietverträge, Leasingverträge und andere langfristige Vertragsverhältnisse betreffen. Lediglich ein erleichterter Personalabbau ist ausgenommen.“
Das Verfahren soll bei drohender Zahlungsunfähigkeit eingeleitet werden können, wobei es genügt, wenn in einem Zeithorizont von 24 Monaten eine Deckungslücke auftritt. Dies ermöglicht ein frühzeitiges Einschreiten der Geschäftsleitung. Im Webinar, geführt von Frau Dr. Bettina Breitenbücher und Frau Prof. Dr. Anette Neußner, liefern zum Gesetz zum neuen Restrukturierungsverfahren (StaRUG) 1. Januar 2021 Avivre Consult und BREITENBÜCHER Rechtsanwälte mehr Einzelheiten.
Themen: Health Care Rating, Immobilienrating, Pflegeheimrating | Kommentare deaktiviert für Neue Möglichkeiten zur Restrukturierung
Erste Entwarnung für die Schifffahrtsbranche
Von Dr. Oliver Everling | 11.November 2020
Die Ratingagentur Moody’s hat den Ausblick der globalen Schifffahrtsbranche von negativ auf stabil revidiert. Die globale Schifffahrtsbranche ist auf dem besten Weg, insgesamt eine bessere Leistung zu erbringen, als die Ratingagentur in diesem Jahr erwartet hatte: „Wir erwarten, dass das Gesamt-EBITDA der von uns weltweit bewerteten Schifffahrtsunternehmen im Jahr 2021 aufgrund einer Erholung um 3 % bis 5 % wachsen wird, im Trockenmassensegment aufgrund von Pandemietiefs und der Fortsetzung guter Marktgrundlagen für die Containerschifffahrt.“
Dies wird jedoch durch einen wahrscheinlichen Rückgang des EBITDA im Tankersegment im nächsten Jahr aufgrund harter Vergleiche mit den Rekordcharterraten im ersten Halbjahr 2020 gemindert. Das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage in der Branche wird sich voraussichtlich im Jahr 2021 verbessern, so Moody’s, und ist daher Hauptgrund für die Änderung des Ausblicks.
Die Risiken bleiben jedoch bestehen, warnt Moody’s. Eine schwache Erholung der Weltwirtschaft hat Einzug gehalten, aber anhaltende Pandemieängste und ein Wiederaufleben der Coronavirus-Infektionen in einigen großen Volkswirtschaften könnten eine Erholung der Nachfrage nach Schifffahrtsdienstleistungen im Jahr 2021 behindern. „Unsere Aussichten für die globale Schifffahrtsbranche waren seit März 2020 negativ.“
Das begrenzte Angebot an neuen Schiffen und das Kapazitätsmanagement sollten nach Ansicht der Analysten als Polster für ungünstige Marktbedingungen dienen. Die Auftragsbücher für alle drei Schifffahrtssegmente bleiben im Verhältnis zur Gesamtflotte auf Rekordtief. Selbst ohne eine echte Erholung oder eine mäßige Nachfrageverringerung würden die verschiedenen Segmente ein begrenztes Wachstum der neuen Kapazitäten verzeichnen.
Im Segment der Containerschifffahrt könnten die Spediteure die Annullierung von Fahrten wieder aufnehmen, um die Kapazität entsprechend der Nachfrage zu verringern. Die Tanker- und Trockenmassenmärkte werden jedoch im Jahr 2021 empfindlicher auf Änderungen der Nachfrage reagieren, da sie viel stärker fragmentiert sind als der globale Containermarkt, auf dem die Kapazität teilweise durch Allianzen organisiert ist. Mehr dazu in Moody’s Research „Shipping – Global Outlook turns stable on EBITDA growth, improving supply-demand balance“.
Themen: Branchenrating | Kommentare deaktiviert für Erste Entwarnung für die Schifffahrtsbranche
Schlüsseltresore im Rating
Von Alex Bergmann | 11.November 2020
ANZEIGE
Schlüsseltresor: praktisch, robust und sicher
Schlüssel an sich sind bereits ein wichtiger Sicherheitsgegenstand. Mit einem Schlüssel wird Zugang zu Gebäuden und damit auch Wertsachen gewährt. Da spielt Sicherheit eine wichtige Rolle. Gerade dann, wenn mehrere Schlüssel im Spiel sind, ist ein Schlüsseltresor die perfekte Lösung. Denn im Schlüsseltresor lassen sich Schlüssel absolut sicher und zugleich auch ordentlich aufbewahren. Die Aufbewahrungslösung für Schlüssel ist nicht nur im gewerblichen Bereich vertreten, sondern wird auch zunehmend im privaten Kontext verwendet.
Welche Funktion erfüllt der Schlüsseltresor?
Der Schlüsseltresor ist immer dann die perfekte Lösung, wenn mehrere Personen Zugriff auf einen Schlüssel haben. Sehr oft kommt der Schlüsseltresor im medizinischen Bereich zum Einsatz – in Kranken- oder Pflegehäusern. Aber auch Hausverwaltungen, Reinigungskräfte, Schulen, Kindergärten und Büros sind immer öfter mit den praktischen Tresoren zur Schlüsselaufbewahrung ausgestattet. Die Schlüsselbox bietet einerseits die perfekte Übersicht für alle Schlüssel, die verwaltet werden müssen. Dazu begeistert der Schlüsseltresor andererseits mit maximaler Ordnung. Denn es haben nur die Personen Zugriff auf die Schlüssel, die ihn benötigen.
Welche Vorteile bietet ein Schlüsseltresor?
- Schlüssel lassen sich ordentlich aufbewahren
- Optimale Übersicht aller Schlüssel ist gewährleistet
- Eignet sich sowohl für den privaten als auch gewerblichen Nutzen
- Bietet ein hohes Maß an Sicherheit
Der Schlüsseltresor als abschließbarer Safe
Ob Schlüsseltresor oder Schlüsselsafe – die einzelnen Tresore haben immer die Funktion, die Schlüssel sicher und zugleich ordentlich aufzubewahren. Es gibt jedoch viele unterschiedliche Ausführungen. Das wird gerade bei dem Sicherheitsaspekt deutlich. Es gibt beispielsweise Schlüsseltresore, die mit einem Zahlen- oder Drehkombinationsschloss ausgestattet sind. Hier wird eine individuelle Zahlenkombination festgelegt, mit der sich der Tresor öffnen lässt. Das Eine Alternative wäre der Schlüsseltresor mit Schlüsselschloss. Der Tresor ist mit einem Zylinderschloss ausgestattet und lässt sich nur mit einem Generalschlüssel oder einer Schlüsselkarte öffnen.
Schlüsseltresore für jeden Anwendungsbereich
Im gewerblichen Rahmen sind Schlüsseltresore unfassbar wichtig. Hier spielen Ordnung, Sicherheit und Einbruchsschutz eine wesentliche Rolle. Deswegen gibt es Schlüsseltresore auch in vielen Ausfertigungen. Unterschiede sind nicht nur bei dem Verschluss zu finden. Auch die Größe kann sehr unterschiedlich ausfallen. Wer einen Schlüsseltresor für den privaten Bereich sucht, wird ebenfalls überrascht sein. Es gibt sehr kompakte Schlüsseltresore, die sich beispielsweise direkt am Briefkasten anbringen lassen. Am Ende spielt es also keine Rolle, für welchen Zweck man einen Schlüsseltresor sucht. Er punktet immer mit maximaler Sicherheit.
ANZEIGE
Themen: OR-Rating, Werbung | Kommentare deaktiviert für Schlüsseltresore im Rating
MicroVision kommt der Vision näher
Von Dr. Oliver Everling | 10.November 2020
MicroVision, Inc. (NASDAQ: MVIS), ein führender Anbieter innovativer Laserstrahl-Scantechnologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen wichtige Fortschritte bei der Entwicklung seines LRM-Sensormoduls (Dynamic Scanning Long Range Lidar) der ersten Generation erzielt hat. Fortschritte gibt es insbesonders, die wichtigsten Anforderungen der Automobilindustrie zu erfüllen, von denen das Unternehmen glaubt, dass sie das Entwicklungsziel der Herstellung von Hardware für Demonstrations- und Benchmarking-Verfahren bis April 2021 erleichtern werden. Diese ersten Produkttests zeigten wichtige Ergebnisse, zum Beispiel die Fähigkeit, eine Reichweite von 200 Metern zu erreichen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass weitere Fortschritte bei der Entwicklung dieser Funktionen wichtig sind, um potenzielle strategische Alternativen zu verfolgen, die einen Verkauf oder eine Fusion des Unternehmens umfassen könnten.
MicroVision ist der Entwickler der PicoP®-Scantechnologie, einer Ultra-Miniatur-Sensor- und Projektionslösung, die auf der vom Unternehmen entwickelten Laserstrahl-Scan-Methode basiert. Dank des Plattformansatzes von MicroVision für diese Sensor- und Anzeigelösung kann die Technologie an eine Vielzahl von Anwendungen und Formfaktoren angepasst werden.
„Wir gehen davon aus, dass die Automobilindustrie nach Lidar-Produkten mit großer Reichweite ein Ziel mit einem Reflexionsgrad von 10% auf 200 Metern erkennen muss, um einem Lidar-Sensor die Möglichkeit zu geben, ein Stück Reifen auf der Fahrbahn in diesem Bereich zu erkennen mit einem Fahrzeug, das sich mit Autobahngeschwindigkeit solchen Gefahren auszuweichen hat. Ich glaube, das MicroVision-Team ist auf dem besten Weg, dass unser LRL-Sensormodul der ersten Generation dieses Ziel erreicht und darüber hinaus eine hohe Auflösung bei voller Reichweite bietet“, sagte Sumit Sharma, Chief Executive Officer von MicroVision. „Unsere ersten Produkttests haben auch gezeigt, dass das Sensormodul mit unserer neuen, proprietären MEMS-Scan-Technik, von der wir erwarten, dass sie auch ein Schlüsselmerkmal jedes zukünftigen Produkts sein wird, das „Rauschen“ von Sonnenlicht und anderen Lichtquellen unterdrücken kann. Ich glaube auch, dass das Vertrauen in unsere Fähigkeit, diese Funktionen in unser Sensormodul zu implementieren, MicroVision auf den richtigen Weg bringt, um die wichtigsten Anforderungen der Lidar-Technologie für Automobilhersteller zu erfüllen, und MicroVision einen strategischen Vorteil im LRL-Bereich verschafft.“
„Wir freuen uns über die Fortschritte, die wir bei der Entwicklung unseres MEMS-LRL-Sensormoduls der ersten Generation erzielen“, fuhr Sharma fort. „Durch die frühzeitige Entwicklung und Demonstration dieser Kernfunktionen können wir im April 2021 Hardware für Tests zur Verfügung stellen.“
Umfangreiche Forschungen haben MicroVision zu einem unabhängigen, anerkannten Marktführer bei der Entwicklung von geistigem Eigentum gemacht. Das IP-Portfolio von MicroVision wurde vom Patent Board als eines der 50 besten IP-Portfolios unter den globalen Industrieunternehmen anerkannt und in den Ocean Tomo 300 Patent Index aufgenommen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Redmond, Washington.
Themen: Aktienrating, Technologierating | Kommentare deaktiviert für MicroVision kommt der Vision näher
USA bleibt der Nachschub aus China aus
Von Dr. Oliver Everling | 10.November 2020
Bleibt den USA der intellektuelle Nachschub aus? Prof. Dr. Sebastian Heilmann, Lehrstuhl für Regierungslehre/Politik und Wirtschaft Chinas an der Universität Trier, berichtet bei der 33. FERI Jahrestagung von alarmierenden Zahlen.
Sebastian Heilmann spricht bei der alljährlichen Tagung der FERI über „Bifurkation“ oder „Neuer Kalter Krieg“? Es geht um Konsequenzen der strategischen Rivalität zwischen den USA und China für europäische Investoren. Er analysiert die Bindekräfte: Was bremst eine radikale Abkopplung? Hierzu geht er auf grenzüberchreitende Transaktionen und den Austausch zwischen den USA und China ein.
Das Jahr 2020 brachte den USA eine einschneidende Entwicklung: Während bisher hunderttausende chinesische Studenten in die USA strömten, bleiben diese heute in China. Sebastian Heilmann spricht von einem Rückgang von 99 %, der sich klar am Rückgang der Visa und Anträge bemessen lässt.
Sebastian Heilmann spricht von den drastischen Konsequenzen, die die ausbleibenden Chinesen für die amerikanischen Forschungslabore haben. So bleibe in den USA der Nachschub an hoch qualifizierten und hoch motivierten Arbeitskräften in wichtigen Forschungsbereichen aus.
Während im Februar 2020 die Sorge der Industrie im Westen sich noch auf die unterbrochenen Lieferketten durch Lockdowns in China bezog, geht es nun um Humankapital. So kann es auch für die Kapitalmärkte spürbare Konsequenzen haben, wenn junge Talente künftig in China ihre Karrieren suchen und nicht mehr in den USA.
„Rund ein Drittel aller Absolventen in den Technik- und Naturwissenschaften kommt aus China“, fügt Sebastian Heilmann hinzu und macht damit klar, welches Gewicht die skizzierten Verschiebungen für das Verhältnis zu den USA haben.
Themen: Länderrating | Kommentare deaktiviert für USA bleibt der Nachschub aus China aus
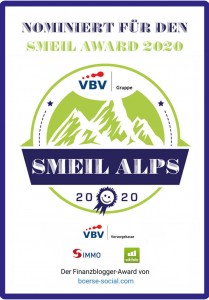
 Börse hören. Interviews zu aktuellen Ratingfragen im Börsen Radio Network. Hier klicken für alle Aufzeichnungen mit Dr. Oliver Everling seit 2006 als Podcasts.
Börse hören. Interviews zu aktuellen Ratingfragen im Börsen Radio Network. Hier klicken für alle Aufzeichnungen mit Dr. Oliver Everling seit 2006 als Podcasts.










